Kurzbericht vom IMAPS-Frühjahrsseminar in Halle/ Saale
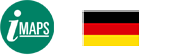
Am 25.2.2025 war das IMWS Halle unser Gastgeber für das IMAPS-Frühjahrsseminar unter dem Thema „Zuverlässige Elektronik – made in Europe“. Der Geschäftsfeldleiter »Werkstoffe und Bauelemente der Elektronik« Frank Altmann stellte in seiner Einführungspräsentation die dortigen Kompetenzen in der Analyse und Materialdiagnostik von mikroelektronischen Bauteilen bis hin zu komplexeren Systemen anschaulich vor. Die erste Session startete mit einem Beitrag der Indium Corp., präsentiert durch Andreas Karch zum Thema „Moderne hochzuverlässige Lotpasten System für Anwendungen mit nachhaltig langen Mission Profilen“. Anforderungen von mehreren tausend Temperaturzyklen fordern immer neue Entwicklungen, um die vermeintlich „ausgereizten“ Bleifreilötverbindungen immer noch etwas besser zu machen. Er ging auf spezielle Lotlegierungen für hochzuverlässigen Einsatz und den Einfluss von Verweilzeiten und Temperatur über Liquidus ein. Auch ums Thema Löten ging es Kurt Jürgen Lang von ams-Osram, der das „Solderpad design and processing for reliable LED applications“ aufgriff und zeigte, wie sich verschiedene Pad- und Lötstoppdesigns auf Zuverlässigkeiten von Lötverbindungen auswirken können. Dazu wurden Einflüsse auf Fehlermodi wie Risse im Solderjoint, Padlifting und Risse der Anschlussleitbahn zum Pad als Auswirkungen thermischen Cyclings untersucht und quantifiziert. Viele der Zuhörer fanden den Vortrag von Oliver Albrecht, TU / ZMP Dresden besonders anschaulich, da er sich meist unsichtbaren Details beim Löten widmete. Die dortige Arbeitsgruppe entwickelte ein „In-situ Röntgenverfahren zur Charakterisierung von Lötprozessen und thermomechanischen Vorgängen“. In ihr Röntgengerät bauten sie eine Messzelle mit Profilsteuerung, Gas- und Abgasführung, Evakuierungsmöglichkeit und Messung aller Parameter ein, die den Lötvorgang unter laufender Röntgeninspektion sichtbar werden lässt. Das veranschaulichte er beispielhaft an einer größeren Chiplötung und an BGA-Verbindungen. Der krankheitsbedingte Ausfall des Beitrags der TU Chemnitz konnte spontan kompensiert werden, da einige anwesende Projektpartner bzw. inhaltlich involvierter Teilnehmer jeweils etwas zu den geplanten Vortragsschwerpunkten beitragen konnten.
Den zweiten Block mit dem Schwerpunkt Powermodule begann Martin Rittner von der Robert Bosch GmbH zum Thema „Robuste Leistungsmodultechnologien: Herausforderung für die Modulqualifikation“. Er arbeitete Potenziale des Kupfersintern heraus, die weit über den Kostenvorteil hinaus gehen. Insbesondere im Zuverlässigkeitsbereich wurden Vorteile bei der Robustheit im Power Cycling herausgearbeitet, die unter anderem aus besserer Anpassung bezüglich thermischer Ausdehnung und Streckgrenze resultieren.
 Marco Rudolph vom gastgebenden Fraunhofer IMWS stellte anschließend Ergebnisse zu „Beschleunigter Zuverlässigkeitsbewertung für Bodenplattenmetallisierungen von Power-Modulen“. Untersucht wurden hier insbesondere die Beschaffenheiten verschiedener Metallisierungen im initialen Zustand, nach dem Lötprozess bei 320°C und nach beschleunigter Alterung von 300h @200°C. Es wurden signifikante Schädigungen einzelner Baseplates im Schichtsystem der Metallisierungen gezeigt, die an realen Baugruppen ausfallrelevant sein können. „Power-Cycling, Livetime modelling based on separation of microstructural degradation mechanisms and their interrelation with electrical functionality » war der Arbeitstitel des Vortrags von Markus Leicht, Schaeffler/Vitesco Technologies. Die untersuchten SiC-MOSFET zeigten nach der Belastung verschiedene Riss- bzw. Delaminationsbilder, die für die Bewertung der Schichtsysteme und speziell der Prozessoptimierung auf der Chipvorderseite Verwendung finden. Den Abschluss der Powerblocks bildete Stefan Wagner vom Fraunhofer IZM mit „Thermisch und Feuchte getriebene Fehler in der Anwendung von leistungselektronischen Systemen“. Am Beispiel von Leistungsmodulen in Windkraftanlagen wurden Fehlermechanismen und Zusammenhänge mit Standortbedingungen der Anlagen erläutert. Die Schädigungen, die viele Teilnehmer aus der Miniaturisierungsperspektive kennen, sahen sie hier auch an Bauteilen und Baugruppen der Dimensions- und Leistungsklasse von Windturbinen. Ausfälle und ließen sich hier standort- und jahreszeitlich saisonal bedingt begründen.
Marco Rudolph vom gastgebenden Fraunhofer IMWS stellte anschließend Ergebnisse zu „Beschleunigter Zuverlässigkeitsbewertung für Bodenplattenmetallisierungen von Power-Modulen“. Untersucht wurden hier insbesondere die Beschaffenheiten verschiedener Metallisierungen im initialen Zustand, nach dem Lötprozess bei 320°C und nach beschleunigter Alterung von 300h @200°C. Es wurden signifikante Schädigungen einzelner Baseplates im Schichtsystem der Metallisierungen gezeigt, die an realen Baugruppen ausfallrelevant sein können. „Power-Cycling, Livetime modelling based on separation of microstructural degradation mechanisms and their interrelation with electrical functionality » war der Arbeitstitel des Vortrags von Markus Leicht, Schaeffler/Vitesco Technologies. Die untersuchten SiC-MOSFET zeigten nach der Belastung verschiedene Riss- bzw. Delaminationsbilder, die für die Bewertung der Schichtsysteme und speziell der Prozessoptimierung auf der Chipvorderseite Verwendung finden. Den Abschluss der Powerblocks bildete Stefan Wagner vom Fraunhofer IZM mit „Thermisch und Feuchte getriebene Fehler in der Anwendung von leistungselektronischen Systemen“. Am Beispiel von Leistungsmodulen in Windkraftanlagen wurden Fehlermechanismen und Zusammenhänge mit Standortbedingungen der Anlagen erläutert. Die Schädigungen, die viele Teilnehmer aus der Miniaturisierungsperspektive kennen, sahen sie hier auch an Bauteilen und Baugruppen der Dimensions- und Leistungsklasse von Windturbinen. Ausfälle und ließen sich hier standort- und jahreszeitlich saisonal bedingt begründen.
IMAPS-Veranstaltungen haben immer auch den Austausch der Vortragenden, Aussteller und Teilnehmer im Fokus. Insofern sind die Pausengespräche ebenso wichtig wie die Inhalte. Die eine oder andere Forschungskooperation oder kommerzielle Zusammenarbeit ist aus einem Gespräch in der Pause auf einer Konferenz oder Seminar entstanden. Nach der Mittagspause startete Christoph Hecht vom FAPS in die dritte Runde. „Chipnahe 3D-Funktionalisierung von DCB Substraten für leistungselektronische Anwendungen“ lautete sein Vortrag, der sich mit partiell pulvergesinterten Schichten von DCB beschäftigte. So erzeugte sowie auch nachträglich vergütete Schichten wurden bezüglich ihres Matchings zu simulierten thermischen Eigenschaften untersucht. Für die BTU trug Gregor Wiedemann etwas zur „Transienten Systemlevel-Simulation – Modellentwicklung und experimentelle Validierung der Online-Sperrschicht-Temperatur“ vor. Forschungsgegenstand war hier die Implementierung einer indirekten Temperaturmessung in IGBT-Modulen. Um aus dem Bauteil selbst die Temperaturinformation zu bestimmen, mussten die verschiedenen Abhängigkeiten bestimmt und mehrstufigem Kurvenfitting unterzogen werden.
Teilnehmer im Fokus. Insofern sind die Pausengespräche ebenso wichtig wie die Inhalte. Die eine oder andere Forschungskooperation oder kommerzielle Zusammenarbeit ist aus einem Gespräch in der Pause auf einer Konferenz oder Seminar entstanden. Nach der Mittagspause startete Christoph Hecht vom FAPS in die dritte Runde. „Chipnahe 3D-Funktionalisierung von DCB Substraten für leistungselektronische Anwendungen“ lautete sein Vortrag, der sich mit partiell pulvergesinterten Schichten von DCB beschäftigte. So erzeugte sowie auch nachträglich vergütete Schichten wurden bezüglich ihres Matchings zu simulierten thermischen Eigenschaften untersucht. Für die BTU trug Gregor Wiedemann etwas zur „Transienten Systemlevel-Simulation – Modellentwicklung und experimentelle Validierung der Online-Sperrschicht-Temperatur“ vor. Forschungsgegenstand war hier die Implementierung einer indirekten Temperaturmessung in IGBT-Modulen. Um aus dem Bauteil selbst die Temperaturinformation zu bestimmen, mussten die verschiedenen Abhängigkeiten bestimmt und mehrstufigem Kurvenfitting unterzogen werden.
Um geringere Leistungen ging es in den letzten beiden Beiträgen von Johannes Zeh, CiS Erfurt und Jens Müller von der TU Ilmenau. Herr Zeh zeigte Ergebnisse seiner Untersuchungen zur „Zuverlässigkeit von Sensorsignalen“, konkret von Drucksensoren, die auf einem TO-Sockel montiert werden. Die auftretenden Montageverspannungen verursachen u.a. Drift, sodass sie bezüglich ihres Einflusses und Wirkmechanismus verstanden und reduziert werden müssen. Jens Müller stellte Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt vor, das sich mit „LTCC und LTCC Verbundsubstraten für sensorische Anwendungen unter harten Einsatzbedingungen“ beschäftigte. Aus dieser Technologieplattform entstanden beispielsweise ein glasgebondeter Sensor dessen Fügezone aktiv beheizbar ist, ein Differenzdrucksensor, eine Sensorküvette für Ölqualitätsprüfung auf IR-Basis sowie ein Torsionssensor aus einer gewölbten LTCC, der auf der Welle einer Windturbine platziert wird.
Zum Abschluss gab Martin Schneider-Ramelow einen Ausblick auf das Konferenzjahr 2025, das aus europäischer Sicht insbesondere die EMPC Grenoble bereithält.